Schwacher Gerritsen-Krimi
 Neulich habe ich gesehen, dass spiegel.de auffallend grosse Werbung für Leichenraub macht, den neuen Krimi von Tess Gerritsen. Tatsächlich ist der Name Gerritsen Garantie für Krimiliteratur, die mit Sachkenntnis über Pathologie zu packen weiss. Und ihre Plots erreichen jeweils vor lauter Rasanz fast schon Überschallgeschwindigkeit. "Leichenraub" aber bietet plotmässig wenig als nervöses Gehetze.
Neulich habe ich gesehen, dass spiegel.de auffallend grosse Werbung für Leichenraub macht, den neuen Krimi von Tess Gerritsen. Tatsächlich ist der Name Gerritsen Garantie für Krimiliteratur, die mit Sachkenntnis über Pathologie zu packen weiss. Und ihre Plots erreichen jeweils vor lauter Rasanz fast schon Überschallgeschwindigkeit. "Leichenraub" aber bietet plotmässig wenig als nervöses Gehetze.Empfehlen kann ich höchstens die Lektüre der ersten 40 bis 50 Seiten. Auf ihnen nimmt sich Gerritsen einer Frage an, an dem sich schon zahllose werdende Mütter mehr oder weniger wohlig gegruselt haben mögen: Wie kamen Babies zur Welt, als die moderne Medizin noch in den Kinderschuhen steckte? Ohne Fachlatein, aber kundig und hoch emotional schildert Gerritsen, was das Kindbettfieber in einem Bostoner Spital des frühen 19. Jahrhunderts anrichtet (nichts für zarte Gemüter).
Die Haupthandlung des Buches aber ist in der Gegenwart angelegt: Die Heldin findet im Garten ihres neuen Hauses ein Skelett. Irgendwie stehen die Knochen im Zusammenhang mit den Geschehnissen rund um zwei Ärzte in der Vergangenheit. Sie haben herausgefunden, wie man das grassierende Kindbettfieber aus den Spitälern vertreiben könnte: mit mehr Hygiene. Eine Idee, die die amtierenden Oberärzte erst lächerlich, dann zusehends bedrohlich finden.
Eine an sich spannende Ausgangslage. Doch je länger die Lektüre dauert, desto mehr zerfallen der Plot der Gegenwart und jener der Vergangenheit. Gerritsen zieht noch die unplausibelsten Entwicklungen an den Haaren herbei, um etwas Spannung zu erzeugen. Heldin wird ein Mädchen aus der Unterschicht, das schliesslich ganz nach oben heiratet - eine höchst unwahrscheinliche Entwicklung, was Gerritsen aber nicht zu merken scheint. Und die moderne Heldin reift an ihrem Beispiel durchaus. Aber nicht so, wie sie es laut Madame Frogg sollte.
Es kann nicht gut bestellt sein um das Sortiment des Limes Verlags, wenn er mit diesem Buch eine so kostspielige Werbekampagne bestreitet!
diefrogg - 12. Sep, 13:49
2 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks
 Fröschinnen sollten über einen Helden wie Orhan Pamuk nicht mäkeln. Seine Bücher sind wirklich aussergwöhnlich. Hobbyautorin Frogg jedenfalls mutet es an wie ein Wunder, dass ein Roman wie
Fröschinnen sollten über einen Helden wie Orhan Pamuk nicht mäkeln. Seine Bücher sind wirklich aussergwöhnlich. Hobbyautorin Frogg jedenfalls mutet es an wie ein Wunder, dass ein Roman wie  Jenes hoch umstrittene Buch, in dem der Autor einen fiktiven einstigen Nazi-Schergen auf 1359 Seiten seine Geschichte erzählen lässt.
Jenes hoch umstrittene Buch, in dem der Autor einen fiktiven einstigen Nazi-Schergen auf 1359 Seiten seine Geschichte erzählen lässt.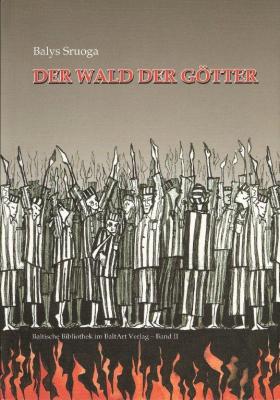 Freunde, hier mache ich für einmal Werbung. Werbung für ein
Freunde, hier mache ich für einmal Werbung. Werbung für ein 



